Livia De Stefani - Trauben schwarz wie Blut
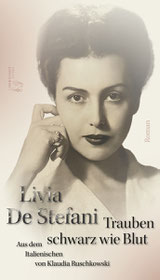
Das Sizilien der 1920er und 30er Jahre ist Schauplatz dieses grandiosen Romans, der einer griechischen Tragödie gleichkommt.
Livia De Stefani führt den Kampf zwischen weltlicher Macht und Ohnmacht dem Schicksal gegenüber mit all den sich daraus ergebenden inneren und äußeren Konflikten bildgewaltig vor Augen. All ihre Figuren kämpfen um ihr Leben, doch mit sehr unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen. Der Protagonist Casimiro Badalamenti, ein niederes Mafiamitglied, kämpft vor allem um seine Ehre - um Menschlichkeit geht es ihm nicht.
Seine Frau Concetta war jahrelang seine Geliebte, die Kinder, die sie ihm gebar, gab er sofort nach der Geburt weg.
Er wollte diese Schande nicht ständig vor Augen haben.
Bis ein Sinneswandel einsetzt, er die ehemalige Prostituierte heiratet, drei der vier Kinder wieder zurückholt, als gemachter Mann in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort den geerbten Weinberg wieder pflegt. Er hat so viel Geld verdient, sich so viel Macht durch die Zugehörigkeit zur Mafia gesichert, dass niemand es mehr wagt, seine Ehrhaftigkeit anzuzweifeln.
Was sich so kurz zusammenfassen lässt, erstreckt sich über mehr als zehn Jahre, ist das Ergebnis heftigster äußerer und innerer Kämpfe, spiegelt nicht nur das scheinbar unsterb-liche Patriarchat sondern auch die Schicksalhaftigkeit der Mafia wieder. Beide sind da, werden nicht hinterfragt, weder von denen, die in der Hierarchie oben, noch von denen, die unten stehen.
Beide, Patriarchat und Mafia, stellt die 1913 auf Sizilien geborene Autorin in den Mittelpunkt ihres 1953 erschienenen Romans, der einen Skandal auslöste. Dieser bezog sich vordergründig auf den Inzest der Geschwister Nicola und Rosaria, doch absolut unerhört war es, dass eine Frau es wagte, über die Mafia zu schreiben, diese auch nur zu erwähnen. Doch der Roman avancierte zum Klassiker, er ist von sehr hoher literarischer Qualität und auch heute noch eine fantastische Lektüre.
In drei Teile gliedert Livia De Stefani ihren Text. Der erste beleuchtet das Leben Casimiros und Concettas, den Kampf Concettas, Kinder bekommen zu dürfen (Casimiro wollte zunächst keine), das Schicksal der Kinder in ihren jeweiligen `Pflegefamilien´ und schließlich die erstmalige Zusammen-kunft der fünfköpfigen Familie.
Nicola, der Erstgeborene, ist nun zehn, er verbrachte eine wunderbare, von Liebe und Geschichten erfüllte Kindheit bei einem einfachen Ehepaar auf dem Land.
Die zwei Jahre jüngere Rosaria erlebte das Gegenteil. Sie war unterernährt, arbeitete wie eine Magd, wurde schlimmer behandelt als ein Tier, ist aber trotzdem nicht verbittert und nun glücklich, bei ihren richtigen Eltern zu leben.
Die kleine Gentilina ist noch ein unbeschriebenes Blatt und spielt keine große Rolle in der Geschichte.
Während sich die Mädchen sofort in ihr neues Leben einfügen, rebelliert Nicola von der ersten Minute an.
"Nicola glühte vor Hass und Neid auf diesen Mann, der so viel stärker war als er. Er nannte sich Padre, er war sein Vater."
Der zweite Teil ist geprägt vom Kampf des Padre-Padrone mit seinem Jungen. Nicola muss schwer arbeiten, wird erniedrigt. Casimiro möchte "dem widerspenstigen Sohn die Verbundenheit zum Land und einen Charakter einpflanzen, der dem seinen entsprach".
Es kommt zu einem Fluchtversuch, ab da fesselt er Vater Nicola mit einer Kette ans Bett, sobald er ihn nicht mehr selbst bewachen kann.
Concetta hatte er, nachdem sie seine Geliebte geworden war, verboten, das Haus zu verlassen. Die monatelange Gefangen-schaft akzeptierte sie, bis sie mit einer List - nicht mit offener Gegenwehr - erwirkte, dass sie wieder ausgehen durfte.
Sie weiß, wo ihr Platz ist:
"Du bist der Herr. Mein Herr." - "Die uralte Pflicht, sich der Herrschaft des Mannes zu unterwerfen, die ihr im Blut lag..." - "Und Concetta, die selbst in ihrer Seele seine Sklavin war, stand auf und gehorchte" - um nur ein paar Beispiele anzu-führen, die ganz deutlich ausdrücken, wie fest verankert das patriarchale Denken nicht nur in Männerköpfen ist.
Nicola lässt sich nicht so einfach unterwerfen. Er wehrt sich, je älter und stärker er wird, desto massiver. Er ist sechzehn, da verlangt Casimiro, dass er sich selbst anbindet, körper-lich ist Nicola seinem Vater nun überlegen.
An einem Nachmittag, an dem Nicola in Ketten liegt, findet Rosaria einen Weg, um zu ihm zu gelangen. Sie steigt über eine Leiter in seine Kammer ein, beide weinen, dann fängt Nicola an zu erzählen. Er erzählt von seiner glücklichen Kindheit, Rosaria meint, ein Märchen zu hören.
Sie wird immer wieder kommen, die Magie der Geschichten ist stärker als die Angst vor dem "schwarzen Mann".
Die beiden werden vollends zu Seelengeschwistern, einander in die Arme getrieben von einem brutalen Vater, einer ohn-mächtigen Mutter, der Sehnsucht nach Liebe.
Sie wissen um ihre Schuld, die eine Todsünde ist.
Im letzten Teil versucht Concetta die Ehre ihrer Tochter, und damit die der ganzen Familie, mit Hilfe einer schnellen Heirat mit einem Amerikaner zu retten. Doch als sie versteht, was passiert ist und Casimiro ins Bild setzt, rollt der Roman auf die unvermeidliche Katastrophe zu. Denn, eine Tat wie diese ist nur mit Blut abzuwaschen. Und es ist klar, wer bluten muss:
"Der Mann ist der Schuld des Fleisches von Anbeginn an weniger schuldig als die Frau", so Casimiro, der "Mann der Mafia," die sich als "geheime Macht ... über dem mittleren Westen Siziliens erhebt und ihren Schatten auf ihn wirft."
Nachdem er so viel investiert hat, um zu einem der ehren-werten Männer zu werden, opfert er lieber seine Tochter, als seinen gesellschaftlichen Stellenwert aufzugeben.
So deutlich die Kritik an den bestehenden Verhältnissen, so tragisch-dramatisch die Handlung ist, so poetisch sind viele Passagen. Livia De Stefani versteht sich auf zarte Beschreibungen, die sehr eindrücklich sind:
"Nicola und Rosaria trafen sich neben dem Orangenbaum, am ersten Nachmittag, an dem die Schmetterlinge zum Vorschein kamen, wie Stiefmütterchen, vom Wind gewiegt. Hoch über ihrem Trudeln glitten die Raben mit ausgebreite-ten Flügeln durch die warme Luft und stießen klagende Schreie aus. Nicola zeigte auf den Baum und sagte: ` Sieh nur, die neuen Zweige sind gesprossen. Das sind die ganz hellen, mit langen Dornen bewaffnet, zu ihrem Schutz.´ ... `Wann wird die Blüte aufbrechen?´ `Schon bald. Ende April ist der Baum mit weißen Sternchen übersät. Siehst du, die Knospen sind alle schon bereit. Außer an den neuen Zweigen. Der Orangenbaum bildet überall Blüten aus, unregelmäßig, das ganze Jahr lang. Er ist ein verzauberter Baum, ich hatte es dir gesagt.´"
Die Orangenbäume sind das Gegengewicht zum Alltag mit seinen Härten, Ketten und Peitschen.
"Die leuchtenden Orangen neben den betörend duftenden Blüten - sie sind der Gegenzauber zum zerstörerischen Schwarz des Mannes und seiner Trauben; der Inbegriff von Freiheit und Leben, von Reinheit und Liebe", wie Monika Lustig und die Übersetzerin Klaudia Ruschkowski in ihrem profunden Nachwort schreiben.
Klaudia Ruschkowski hat diesen außergewöhnlichen Roman, in dem sich Macht und Ohnmacht gegenüberstehen, der eine Zeit heraufbeschwört, die vielleicht gar nicht vergangen ist oder gerade wiederkehrt, mit all seinen Leidenschaften, psychologischen Finessen und Härten, landschaftlichen Schönheiten und brutalen Hierarchien, wunderbar ins Deutsche übertragen.
Hier noch eine kleine Kostprobe:
"Und so machen sie es auch (ihre Gefühle füreinander geheim zu halten), zu ihrer beider Unglück, welches schon im Buch des Schicksals geschrieben stand, seit Nicola nach der ersten Begegnung mit dem noch unbekannten Vater gespürt hatte, wie eine undurchdringliche Dunkelheit auf ihn herab-sank und ihn auf finstere Wege führte. Jetzt aber, mitten in dieser Dunkelheit, empfing er plötzlich durch einen neuen Spalt Licht und Wärme, ihm schien, als würde er aus einer todesähnlichen Ohnmacht wiedergeboren. Das Licht drang von außen ein und immer lebhafter, seit Rosarias Zuneigung zu einer Gewissheit geworden war; die Wärme indessen entstand in seinem eigenen Körper, sie entströmte ihm, überfiel ihn wie die Juliluft, erfüllte ihn mit dem Wunsch nach frischen Wiesen, auf denen er sich am liebsten singend herumgekugelt hätte."
Ist das nicht Lesegenuss pur?!
Livia De Stefani: Trauben schwarz wie Blut
Aus dem Italienischen von Klaudia Ruschkowski
Mit einem Nachwort von Monika Lustig und Klaudia Ruschkowski
Edition Converso, 2025, 256 Seiten
(Originalausgabe 1953)
 Gute Literatur
Meine Empfehlung
Gute Literatur
Meine Empfehlung