Ralf Rothmann - Museum der Einsamkeit
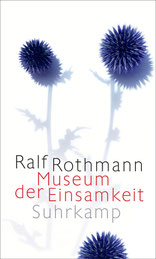
In neun Erzählungen umkreist Ralf Rothmann die Themen Sprache, Sprachverlust, das Unvermögen miteinander zu sprechen, die vielen Möglichkeiten aneinander vorbei zu reden und die daraus erwachsende Einsamkeit. Diese umgibt die Figuren wie ein dicker Mantel, der sie schützt, aber auch von den anderen Menschen trennt.
So in der ersten Erzählung, "Normschrift", die Anfang der 1970er Jahre auf einer "Schulbaustelle" spielt. Hier lernen hundert junge Handwerker vom Bau die Techniken, die auf den modernen Baustellen längst nicht mehr angewandt werden. Die jungen Männer sind in einem ehemaligen Kloster untergebracht, es herrscht eine aufgeheizte Atmos-phäre mit aufgestauten Emotionen, die sich in regelmäßigen Schlägereien entladen. Ein jeder versucht den Coolen zu spielen, ja keine Schwäche zu zeigen, sich selbst unter einer Tarnkappe von Ironie oder Brutalität zu verstecken.
So auch Socke, dessen Mutter die Diagnose Eierstockkrebs erhalten hat:
"Mir tut´s nicht leid, ... überhaupt nicht. Von mir aus soll sie verrecken an ihren Eierstöcken, die Scheiß-Fotze. Die denkt sowieso nur an sich, hat sie immer getan. Keinen Pfennig habe ich von der für mein Mofa gekriegt, obwohl´s ein gebrauchtes war. Die säuft und fickt mit jedem Itaker rum ... Aber was wird aus meinem Hund? Wer kümmert sich um den, wenn die da in ihrem Bett liegt und sich gemütlich operieren lässt?"
Dies sagt er mit Tränen in den Augen zu Simon, dessen Reaktion seine Unsicherheit zeigt:
"Ich schlug Socke auf die Schulter, brachte mein Tablett weg, und ging nach draußen..."
Ralf Rothmann, dessen Erzählungen konzentrierten Romanen gleichen, beschreibt in seinen Texten explizit oder auch zwischen den Zeilen das, was hinter dem Offensicht-lichen liegt. Die Ebene der verborgenen Gefühle, Ängste oder Unsicherheiten meist, die sich nicht direkt in Worte fassen lassen.
Oder nicht direkt an den Adressaten gerichtet werden können. Dies geschieht in den Dialogen zwischen dem Pfarrer Thomsen, der angesichts der tödlichen Krankheit seiner achtjährigen Tochter Pia an seinem Herrn zu zweifeln beginnt, und Pia. Es braucht einen Vermittler zwischen Pia und ihrem Vater, denn es ist zu schwierig, ohne diesen gewisse Dinge sagen zu können. Pia hat sich hierfür eine Handpuppe ausgesucht, "Herr Dingens", ein Reisemitbringsel ihres Vaters.
Zum Beispiel die Frage: "Wirst du die Hanne eigentlich heiraten?" stellt sie noch ganz unverblümt, für ihre Antwort auf Thomsens "Nicht im Traum!" braucht sie Herrn Dingens Beistand:
"Wir möchten nämlich nicht, dass du allein bist. - Wer, wir? - Na, Herr Dingens und ich. Er meinte, das wäre nicht gut für dich, weil du vielleicht wieder so traurig wirst und Pressionen kriegst..."
Pia spricht von ihrer Sorge um den Vater und der Möglichkeit ihres Todes, indem sie den klugen Herrn Dingens sprechen lässt. Damit findet sie immerhin eine Möglichkeit, ihren Gedanken Ausdruck zu geben, womit sie weit klüger und reifer agiert, als mancher Erwachsene in diesen Erzählungen.
In "Eine kleine Metall-Unterhaltung" lässt ein Mann seine Pistole sprechen, in "Die Melodie bei Nacht" läuft die Kommunikation weitgehend nonverbal ab, in "Schimmel in der Orgel" führt Rothmann aus, dass es manchmal auch besser ist, zu schweigen.
Extrem erschütternd ist die letzte Geschichte, "Psalm und Asche". Hier stellt er die Rechtfertigungen eines Lagerleiters in Holland den Aussagen und Erlebnissen Ettys gegenüber, die als junge Frau nach Auschwitz deportiert wurde. Es gibt keinen Rahmen für diesen Dialog über die Zeiten hinweg, das macht ihn universell.
"`Wieso sollte uns jemand helfen? Nichts und niemand wird das tun´, murmelte Etty. `Auch Klagen hilft nichts. Es raubt dir die Kraft, die du dafür brauchst, das Ende zu akzeptieren. Vergiss Amsterdam!´ Sie beugte sich über den schlafenden Säugling, verscheuchte eine Fliege von seiner Stirn. `Das Letzte im Innern, die Wahrheit hinter der Wahrheit, kann dir sowieso niemand nehmen´, fuhr sie fort. `Nirgendwo. Wenn du das verstehst, bist du frei, und das Leben ist wieder wunderbar, auch hier, auch in diesem Moment.´ Und leiser, fast nur für sich, fügte sie hinzu: `So wunderbar wie der Tod.´"
Etty spricht von Wahrheit, Freiheit, Tod. Der Kommandant von Sollzahlen, der guten Arbeit, die er abgeliefert hat, davon, dass er ein Frühchen aufpäppeln ließ, davon dass er "am Ende selbst ein Opfer der Umstände wurde: Auch mich hatte man ja bis zum Prozess in das Lager gesperrt, in mein eigenes Lager!"
Eine jede Erzählung hat ihren Schwerpunkt, jede führt in eine andere Un-Tiefe der Sprache oder Kommunikation.
Ihm selbst stehen dabei sämtliche Register zur Verfügung.
Er schreibt so genau wie einfühlsam, er legt das Nicht-Sagbare in und zwischen das Gesagte, führt vor Augen, auf wie verschiedene Art das miteinander Sprechen nicht funktionieren kann.
Ralf Rothmanns Erzählungen erzählen vom Innersten, von der "Wahrheit hinter der Wahrheit". Jede einzelne wirft einen langen Schatten, sie lassen sich nicht durchlesen und zur Seite legen.
Ralf Rothmann: Museum der Einsamkeit
Suhrkamp Verlag, 2025, 268 Seiten
 Gute Literatur
Meine Empfehlung
Gute Literatur
Meine Empfehlung