Ásta Sigurdardóttir - Streichhölzer
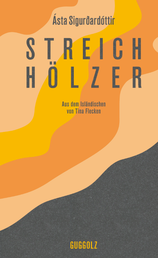
"Wenn jemand darauf geachtet hätte, wie die Frauen mich musterten, kurz bevor ich ging, wie sie sich Blicke zuwarfen, als sie an mir vorbeikamen, hätte er daraus geschlossen:
- Da ist sie, die Schuldige - die Hure.
Wie hätten sie mich auch verstehen können? ... Ich sah aus wie ein Flittchen und starrte alle Männer begehrlich an, musste mich am Stuhl festkrallen, um mich ihnen nicht an
den Hals zu werfen."
So beginnt die erste Erzählung dieses Bandes, die erste auch, die Ásta Sigurdardóttir veröffentlichte, und die sofort einen Skandal verursachte. Sie passte nicht ins Jahr 1951, sie passte nicht nach Island.
Dieser Anfang setzt den Ton und macht klar, dass hier eine Autorin schreibt, die schreiben MUSS. Tabus interessieren sie nicht, Konventionen ebenso wenig, die Geschichten scheinen aus ihr heraus zu drängen, jede einzelne geht an den Kern des Menschseins.
In den wenigen oben zitierten Zeilen spricht sie die Eifer-sucht oder auch Nicht-Solidarität der Frauen untereinander an, sie spricht weibliches Begehren an, das schnell vergebene Etikett "Hure", die Zuweisung "schuldig" - woran ist sie schuldig? An der Untreue der Ehemänner?
Ásta Sigurdardóttir gibt ihrer Heldin den Vornamen, den sie selbst trägt, sie schreibt als Ich-Erzählerin. Dies lockt auf den Weg, die Geschichten autobiografisch zu lesen, zumal die Autorin selbst sehr extravagant lebte.
Sie kam 1930 im Westen Islands zur Welt, wuchs in einer sehr bescheidenen Hütte auf, in einer Gegend, in der es keine Schule gab. Ihre Mutter war eine gläubige Adventistin, der Vater beschäftigte sich mit Heldensagen und Gedichten. In diesem Spannungsfeld unterschiedlicher Erzählungen wuchs das Mädchen, das von Anfang an als "impulsiv und eigen-sinnig" galt, auf. Mit vierzehn ging sie nach Reykjavík, um das Abitur zu machen und das Lehrerseminar zu besuchen. Noch bevor sie dieses beendet hatte, wurde sie schwanger, ihre Mutter nahm das Kind zu sich und zog es auf.
Ásta fiel auf: sie kleidete und schminkte sich wie die Film-stars der damaligen Zeit, verdiente ihr Geld u.a. als Aktmodell, unterhielt Beziehungen zu Männern, trank und kümmerte sich herzlich wenig um gängige Moralvor-stellungen.
Sie wurde "zum Objekt endloser Tratschereien, Verleumdun-gen und Anschuldigungen. Obwohl ihr dies nahe ging, ließ sie sich nicht abhalten und verfolgte unbeirrt ihren Weg", so Dagný Kristjánsdóttir in ihrem profunden Nachwort.
Ásta Sigurdardóttir heiratete zwei Mal, gebar sechs Kinder, trieb ab, schrieb neben den Erzählungen auch Gedichte, malte verstörende Bilder und schuf Linolschnitte.
1971 verstarb sie mit nur einundvierzig Jahren an den Folgen ihres Alkoholkonsums.
Dieser Blick auf Ástas Leben zeigt, dass sie die Situationen, über die sie schreibt, aus eigener Erfahrung kennt.
Sie schreibt vor allem über Frauen in Armut, schwanger, zur Abtreibung gezwungen, ohne Möglichkeit, sich zu bilden und zu entfalten, über die Abhängigkeit von Männern, ohne die es noch schwieriger ist, durchzukommen. Einerseits. Zugleich geht von den Männern eine unglaubliche Gewalt aus, physisch, psychisch, sexuell. Sie betrifft Frauen und Kinder.
Sie schreibt über das, was normalerweise verdrängt wird, und das mit einer unglaublichen Präzision und Wucht.
Sie schreibt so eindrücklich, dass es manchmal schwer fällt, weiter zu lesen, zu ungeheuerlich ist es.
In der Erzählung mit dem Titel "Eine Tiergeschichte" weidet sich der Stiefvater eines sechsjährigen Mädchens an der Panik, die es empfindet, wenn er die Geschichte vom großen Tier, das ein kleines Tier jagt, vorliest. Ihre Panik steigert sich noch, wenn er ihr das dazugehörige Bild zeigt. Es geht so weit, dass das Mädchen vor Angst abmagert, nicht mehr schläft - Gründe, sie unbarmherzig zu verprügeln. Er hasst sie, weil seine Frau es wagt, sich ihm um des Kindes willen manchmal vorsichtig zu widersetzen. Dann muss auch sie gezüchtigt werden.
In einer endlos erscheinenden Szene wird genau der Tod des kleinen Tieres beschrieben, es ist die Geschichte einer Folter. Auch für das Mädchen, die mit dem kleinen Tier leidet, als sei sie selbst das Opfer - sie ist das Opfer, das des großen Tieres Stiefvater.
Hier baut die Autorin noch einen Seitenhieb auf das Christentum ein, denn der Mann wirft seiner Frau vor, das Kind ebenfalls zu quälen, nämlich mit der Kreuzigungs-geschichte, die sei auch nicht besser.
Die Erzählung mit dem harmlosen Titel endet damit, dass Frau und Tochter beinahe getötet werden.
"Der Traum" thematisiert eine Abtreibung, die in Form eines Albtraumes reflektiert wird, in dem Gott und der Teufel eine Rolle spielen. Und das Bürgertum, das auf die blutende Frau herabschaut: "... spöttische, hasserfüllte Gesichter, voll hämischer Schadenfreude ... Mir würde niemals verziehen."
Andere Geschichten erzählen von der erzwungenen Frei-gabe eines Kindes zur Adoption, von zweifelhaften Rettern, von guten Ratschlägen, die sich nur von wohlhabenden Menschen befolgen lassen.
Ásta Sirgurdardóttir spricht deutlich die restriktive Sexual-moral des Bürgertums an, sogar Vögel sollen sich daran halten. Ein Fräulein nennt ihren Vogel schamlos, sie verlangt: "Keine Obszönitäten", stellt fest: "Abscheulich! Diese Natur!". Sie missachtet so lange seinen Freiheitsdrang, bis er in seinem schönen, amerikanischen Käfig stirbt.
Auch der Anwesenheit von amerikanischen Soldaten ab 1940 auf Island widmet sich Ásta Sirgurdardóttir.
Diese veränderten das kleine Land erheblich - zur Befreiung der Frauen und einer Modernisierung des Denkens trugen sie offenbar nichts bei.
Die einzige Erzählung, die die Autorin nicht veröffentlichte, und an der andere Personen herumkorrigiert haben, ist "Frostregen". Sie ist hier in der ursprünglichen Form aufge-nommen. Dagný Kristjánsdóttir schreibt:
"Diese Version der Geschichte ist noch brutaler und drasti-scher. Der Mann trachtet nicht nur nach Rache, sondern er entmenschlicht seine Frau und behandelt sie wie Vieh. Die psychische Gewalt ist dabei noch schwerer zu ertragen als die körperliche."
Es geht hier nicht um Gewaltfantasien, um das sich weiden an Grausamkeit. Ásta Sirgurdardóttir zeigt, wie Menschen mit Menschen umgehen, die sie nicht als gleichwertig sehen, die sich als Richter aufschwingen und sich selbst als über anderen stehend betrachten.
Dies kann auf die Gesellschaft ebenso angewandt werden, wie auf private Beziehungen.
Die starke Erstübersetzung durch Tina Flecken ermöglicht nun die Entdeckung einer einzigartigen Autorin.
Sie transportiert die Kraft und den Geist der Texte aus den 1950er und 60er Jahren, deren Beschreibungen von Abgründen, Vergeblichkeit und Brutalität ganz und gar zeitlos sind.
Das Buch ist eins der besten, die ich jemals gelesen habe!
Ásta Sirgurdardóttir: Streichhölzer
Aus dem Isländischen von Tina Flecken
Mit einem Nachwort von Dagný Kristjánsdóttir
Guggolz Verlag, 2025, 221 Seiten
(Originalausgaben der Erzählungen 1951-67)
 Gute Literatur
Meine Empfehlung
Gute Literatur
Meine Empfehlung